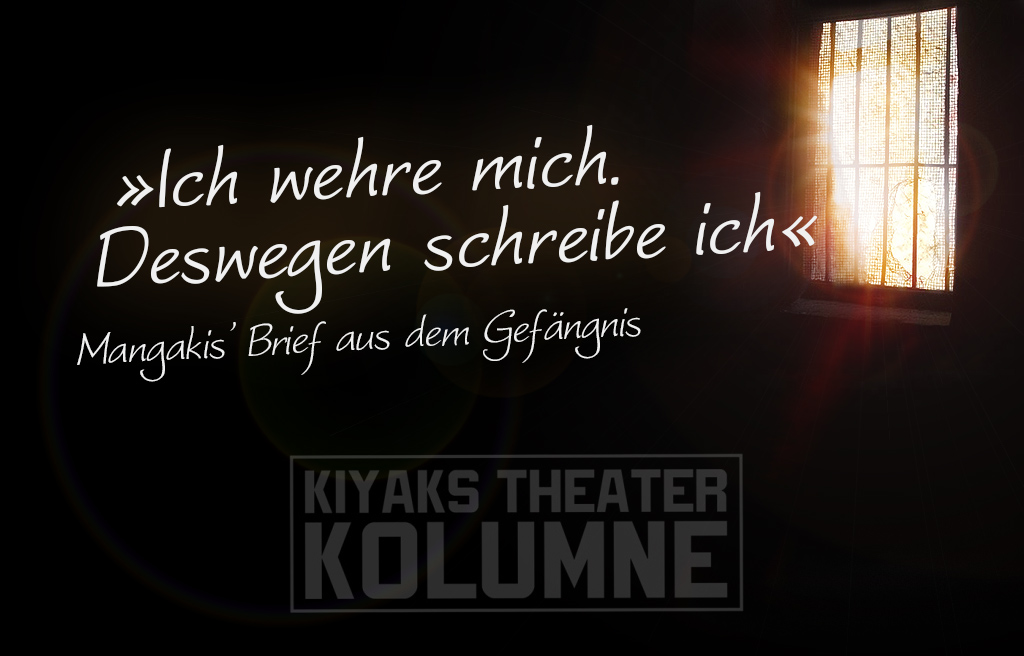 In meiner Jugend begeisterte mich das Genre „Briefe aus dem Gefängnis“. Von Rosa Luxemburg bis Nâzım Hikmet, aber auch die nicht publizierten Anekdoten, Weisen, Lieder, die mündlich weitergetragen wurden, zeigten mir eine Dimension des Lebens auf, die simpel ausgedrückt lautet: Der Weg zur Freiheit führt immer über den Umweg des Kerkers.
In meiner Jugend begeisterte mich das Genre „Briefe aus dem Gefängnis“. Von Rosa Luxemburg bis Nâzım Hikmet, aber auch die nicht publizierten Anekdoten, Weisen, Lieder, die mündlich weitergetragen wurden, zeigten mir eine Dimension des Lebens auf, die simpel ausgedrückt lautet: Der Weg zur Freiheit führt immer über den Umweg des Kerkers.
Die folgenden Jahrzehnte geriet dieser sehr spezielle Bereich der „Literatur in Gefangenschaft“ in Vergessenheit. Zumindest bei mir. Ich las Sachbücher und Gegenwartsromane. Interessierte mich für zeitgenössische Beschreibungen von gesellschaftlichen Konflikten, bei denen es sich hauptsächlich um die Unfreiheit in Freiheit handelte.
Dann wurde Deniz Yücel verhaftet und wenig später gelang es ihm, seinen ersten Brief aus dem Gefängnis zu senden. Tagelang staunte ich Wände, Türen und Bushaltestellen an. Es war also wieder soweit. Wir warten auf Lebenszeichen von Freunden und Weggefährten hinter Gittern. Ein tot geglaubtes Genre war zum Leben erwacht und so aktuell, so wahr und real einerseits und unfassbar andererseits. Man liest, klopft und schüttelt die Zeilen, in der Hoffnung, dass noch irgendwo eine Information herausfällt, irgendein Detail. Gemeinsam mit anderen betreibt man Exegese, setzt alles in einen historischen und politischen Kontext, ehrlich, es ist, als nähme man die Evangelien auseinander.
Seit einiger Zeit lese ich wieder Dichtung von Gefangenen und Texte, die unter Zensur und Diktatur entstehen. Veränderte (Über-)Lebensbedingungen beeinflussen Sprech- und Schreibsprachen. Literaturtheoretisch betrachtet ist es bemerkenswert, wie ähnlich sich die Texte während der Nachkriegsmilitärdiktaturen Griechenlands, Spaniens, Portugal und der Türkei lesen und denen von heute gleichen, wo wie in Russland und der Türkei zwar nicht das Militär herrscht, die politischen Bedingungen aber ähnlich sind: Gleichschaltung der Medien, Verlage und Universitäten, Ausschalten der Opposition.
1971 verfasste Giorgos Alexandros Mangakis, der während der griechischen Militärdiktatur in Haft saß, einen Brief, der um die Welt ging. Er wurde in viele verschiedene Sprache übersetzt. Er ist, wie so vieles, in Vergessenheit geraten.
Die Haft und Folter machten aus dem Insassen, der von Beruf Rechtsprofessor war, einen Autor. Sein Motiv: „Ich wehre mich. Deswegen schreibe ich.“ Der Brief ist ein sagenhafter Essay über Europa und seine Werte, über das Menschsein und die Erniedrigung.
Der freundliche Kostas und seine Kollegen vom Romiosini Verlag waren so großzügig Ihnen, liebe Leser der Theaterkolumne, den vollständigen Text h i e r zur Verfügung zu stellen. Herzlichen Dank dafür.
Ich werde nur einige wenige, gekürzte Passagen zitieren, um einen Eindruck des Textes zu vermitteln, über den die ZEIT schrieb:
„Dieses Dokument könnte in vielen Kerkern der Welt geschrieben sein: Es schildert den unsichtbaren psychischen Terror einer Gewaltherrschaft, die sich erst sicher fühlt, wenn sie den Geist der Freiheit und die Menschenwürde ihrer Widersacher zerbrochen hat.“
Mely Kiyak
Freiheit, meine Geliebte
Brief aus dem Gefängnis, Athen 1971
Giorgos Mangakis
Ich wehre mich. Deswegen schreibe ich.
Sie sperren dich in einem Raum ein, drei Schritte vorwärts, drei zurück. Und du gehst hin und her, ununterbrochen, stundenlang, tagelang. Am Anfang hast du deinen Verstand bei dir, an deiner Seite. Ihr unterhaltet euch, dir wird dadurch manches klar. Du kannst sie erkennen, die dir zuträglichen Ideen. Du erfasst das Böse in äußerster Klarsicht. Das, was den Menschen erniedrigt. Du siehst dich in deinem Recht bestätigt und darum stark. Du wirst sie ertragen, meinst du. Du existierst in dieser Zelle, um die ideelle Substanz des Menschen zu verteidigen.
Aber wie willst du ewig weiter hin- und hergehen, drei Schritte vor, drei zurück, dich mit dir selbst freundlich unterhaltend, mitten in einer entleerten Zeit? Das geht nicht. Diese Schritte knüpfen langsam um dich das Netz des Taumels. Du kannst dich nicht unaufhörlich mit deinem eigenen Verstand unterhalten. Diese zunächst selbstverständliche Entzweiung deines Ichs droht mit der Zeit, dir die Sinne zu spalten.
Wenn wir mit unseren eigenen Gedanken in Eintracht sein wollen, brauchen wir auch die Gedanken des anderen. Und wir brauchen auch die gedankenlose Zeit. Während du so hin- und hergehst, zusammen mit deinem Verstand, wird er allmählich dir gegenüber heimtückisch: Er meldet dir merkwürdige, doch durchaus diskutable Widersprüche an. Das ist es. Das ist die Absicht der Haft, dass du so weit kommst, Dinge, die wider die Vernunft sind mit dir selbst zu diskutieren. So beginnt man sich von der eigenen Position zu entfernen. Hier setzt die Spaltung an, die dich am Ende zum Feind deiner selbst verwandeln wird. Du und dein Verstand, ihr werdet zu zwei Feinden, eingeschlossen in den winzigen Raum der Zelle, mitten im Chaos der Zeit.
Tiefverwurzelt, ungeschützt hat eine Hoffnung mir den Weg gezeichnet, der mich bis in die Wüste des Gefängnisses gebracht hat, ohne Reue, und mich die Haft ertragen lässt, wie jene kleinen Pflanzen, die auch mitten in der Wüste ganz aus sich noch den einen unerklärlichen Tropfen Flüssigkeit selbst hervorbringen, der sie am Leben erhält; ein solcher Tropfen ist meine Hoffnung. Ich könnte es vielleicht so ausdrücken: Es ist die Hoffnung auf die Menschenwürde, die nicht verloren gehen kann, mag sie auch von überall bedroht sein.
Ich habe das Schicksal des Opfers erlebt, und so habe ich das Gesicht des Folterers aus nächster Nähe betrachten können. Die Erregung verlieh ihm – das ist keine Übertreibung – den Ausdruck bestimmter chinesischer Masken.
Foltern ist keine leichte Sache. Es verlangt innere Anteilnahme. Ich hatte also eigentlich Glück. Ich war nicht derjenige, der jemanden erniedrigte. Ich trug nur in meinem schmerzenden Inneren den sehr unglücklichen Menschen. Sie aber müssen, um dich zu erniedrigen, erst in sich selbst den Menschen erniedrigen. Mögen sie auch aufgeblasen in ihrer Uniform herumlaufen, Herren über den körperlichen Schmerz, die Schlaflosigkeit, den Hunger und die Verzweiflung ihres Mitmenschen. Um das durchzuführen, was sie gegen mich durchgeführt haben, haben sie erst den Menschen in sich selbst vernichten müssen. Sie haben mein Martyrium teuer bezahlt.
Als sie die Diktatur errichteten, gehörte ich, ohne es zu wissen, bereits dem Widerstand an. Ich trug mein Schicksal schon in mir. Nichts ist Zufall gewesen. Zufällig waren nur die Einzelheiten der Ereignisse. Doch den Weg, den kannte ich, er war in mir. So wie ich immer an dem Wort hing »Freiheit, meine Geliebte«. Es ist kein Irrtum, dass ich mich im Gefängnis befinde. Ich gehöre hierher.
Mehr Theater Kolumnen …
Hier können Sie Kiyaks Theaterkolumne abonnieren.
